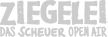Die Seiten der Scheuer wurden in den letzten Wochen überarbeitet und einige Inhalte umstrukturiert.
Der von Ihnen aufgerufene Link exisitiert daher offenbar in dieser Form nicht mehr.
Bitte nutzen Sie die Navigation oben, um die gewünschten Informationen abzurufen.